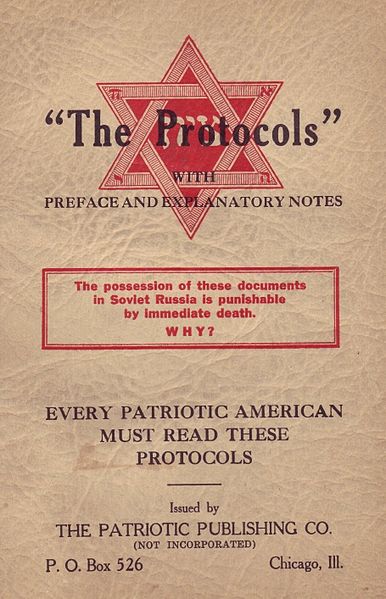"Bist Du, Leser, denn sicher, dass Du meine Sprache verstehst?"
Mit diesen Worten schickt Borges den an dieser Stelle ratlosen Leser seiner wohl bekanntesten 1941 erschienenen Erzählung "Die Bibliothek von Babel" wieder zurück in dessen banale Realität. Doch wer offenen Auges und Geistes durch die Welt geht, der wird immer wieder auf sie treffen, auf die Spiegelungen und Widerspiegelungen der unendlichen Anspielungen, die uns Borges in seinen phantastischen Geschichten hinterlassen hat. Jorge Luis Borges, geboren im Jahre 1899 in Buenos Aires, gilt nicht nur für mich als der unbestrittene Meister der phantastischen Literatur, der als Autor, Herausgeber, Philosoph und nicht weniger als herausragender und schließlich "blinder" Bibliothekar in die (Literatur)Geschichte eingegangen ist, der neben vielem anderen auch Oscar Wilde, Virginia Woolf oder Franz Kafka ins Spanische übersetzte.
"Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt" (J.L.Borges)
Vom Herausgeber der 30-bändigen Sammlung phantastischer Erzählungen, die gleich seiner eingangs erwähnten Geschichte den Titel "Die Bibliothek von Babel" trägt, war hier im Biblionomicon schon des öfteren von ihm die Rede (siehe unten). Natürlich dürfen seine eigenen Erzählungen in dieser umfangreichen Sammlung nicht fehlen und so finden sich im vorliegenden Band Nr. 5 der Reihe auch fünf Geschichten des Meisters, eingeleitet mit einem Vorwort von Martin Gregor-Dellin und gefolgt von einem ausführlichen Interview, das den Leser mit Borges' Geisteswelt vertraut macht.
"Für mich ist die Welt eine unaufhörliche Quelle von Überraschungen, Ratlosigkeiten, von Unglück auch, und manchmal, warum soll ich lügen, von Glück. Aber ich habe keine Theorie über die Welt." (Jorge Luis Borges im Interview)
Gleich zu Beginn des dünnen Bandes führt uns Borges in die Welt der 'Bibliothek von Babel', einem Bücheruniversum, das gleich einem Bienenstock aus einer Unzahl sechseckiger, wabenförmiger Räume besteht, deren Wände als Bücherregale bzw. als Durchgänge zu weiteren gleichartigen Räumen dienen. Das Besondere an dieser Welt sind natürlich die Bücher, die in den tausenden Regalen stehen. Deren Inhalt besteht aus allen möglichen nur denkbaren Kombinationen der Buchstaben des Alphabets, so dass sich nur in wenigen Fällen tatsächlich sinnvolle Buchstabenkombinationen, Wörter oder gar ganze Sätze darin finden lassen -- und das in den unterschiedlichsten Sprachen. So sind die Bewohner dieser Bücherwelt auch beständig auf der Suche nach "sinnvollen" Inhalten, denn die Bücherwelt ist schließlich universal, d.h. alle nur denkbaren Bücher sind in ihr enthalten. So auch das Eine, das Buch der Bücher, das Inbegriff und Auszug aller ist, das den Sinn dieser Welt erklärt. Ich liebe diese kleine Geschichte, die ich bereits vor vielen Jahren kennengelernt hatte. Später dann, während meines Informatikstudiums oder noch später, als ich begann, meine eigenen Vorlesungen vorzubereiten, diente sie mir immer wieder als Beispiel und Motivation für meine Studenten, um ihnen den Informationsbegriff und die Grundlagen der Berechenbarkeit vor Augen zu führen. Wie bereits in einem älteren Blogbeitrag erwähnt, diente die Geschichte auch Umberto Eco als Vorbild für den Aufbau der Klosterbibliothek in seinem Roman 'Der Name der Rose'.
Der '25. August 1983', so ist die zweite Geschichte der Sammlung betitelt, in der sich der jüngere Borges selbst beschreibt, wie er seinem älteren Ich (oder umgekehrt) an eben diesem Datum in einem Hotel begegnet. Ein Traum in einem Traum, Spiegelung und Widerspiegelung bilden auch hier das immer wiederkehrende Leitmotiv. Der Leser fühlt sich stets von neuem in eine phantastisch fesselnde Traumwelt hineinversetzt, so auch in der 'Rose des Paracelsus', in der die 'Leichtgläubigkeit' gegenüber dem 'wahren Glauben' bestehen muss, gegen den sie nicht gewinnen kann, dem 'Blauen Tiger', in der ein Mann ein Tabu bricht und darüber beinahe seinen Verstand zu verlieren droht, oder der 'Utopie des müden Mannes', in der der Erzähler in eine seltsame Welt verschlagen wird, deren Bewohner die Zeit und so manches andere nicht mehr wichtig nehmen. Es gibt nichts, das nicht in Borges' literarischen Träumen stets einer erneuten Reflexion, einer erneuten Anspielung unterzogen wird. Oft reicht es nicht aus, diese Geschichten nur ein einziges Mal zu lesen. Immer wieder kann man Neues in ihnen entdecken und in sie hinein interpretieren.
"Der Buchdruck, der heute abgeschafft ist, war eines der schlimmsten Übel der Menschheit, denn er lief ja darauf hinaus, überflüssige Texte zu vervielfältigen, bis einem schwindlig wurde." (Utopie des müden Mannes)
Ein fast 50-seitiges Interview, gefolgt von einer ausführlichen Zeittafel beschließt das Buch und lässt Borges dabei persönlich zu Wort kommen, wie er dem Leser seine Welt, sein Werk und sein wissenschaftliches Arbeiten nahebringt.
"...es gibt keinen einzigen Grund, warum das Universum von einem gebildeten Menschen des 20. Jahrhunderts oder irgendeines Jahrhunderts begriffen werden sollte. Das ist alles." (Ende des Interviews mit Jorge Luis Borges)
Fazit: Die faszinierende Geisteswelt eines der wohl berühmtesten südamerikanischen Autoren, nicht nur für Liebhaber der phantastischen Literatur, sondern für alle Leser, die die Literatur gelegentlich als Anstoß nehmen, um über ihre eigene Welt nachzudenken. LESEN!
Jorge Luis Borges:
aus Jorge Luis Borges (Hrsg.) 'Die Bibliothek von Babel',
Band Nr. 5,
Edition Büchergilde (2007)
156 Seiten
17,90 Euro
In der Fischer Taschenbibliothek ist jetzt auch eine schöne Sammlung von Jorge Luis Borges bekanntesten Erzählungen als kleines Hardcover-Bändchen erschienen:
Jorge Luis Borges:
Fischer Tb. (2010)
528 Seiten
10,- Euro
Weitere Rezensionen im Biblionomicon zur 'Bibliothek von Babel' und zu Jorge Luis Borges:
- Ein Blick hinter die Fassade in den Abgrund - Leon Bloy "Unliebsame Geschichten", Bibliothek von Babel, Bd. 4
- ...und die Moral von der Geschicht' - William Beckford "Vathek", Bibliothek von Babel, Bd. 3
- Morbide und düster - Pedro de Alarcon "Der Freund des Todes", Bibliothek von Babel, Bd. 1
- Filigran, Bizarr und faszinierend - Jorge Luis Borges "Erzählungen II"